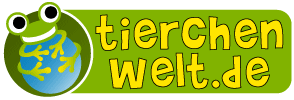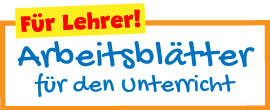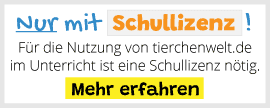Wallaby

Steckbrief Wallaby
| Größe | 52-105 cm |
| Geschwindigkeit | Bis 48 km/h |
| Gewicht | 4-19 kg |
| Lebensdauer | 8-10 Jahre |
| Nahrung | Knospen, Farne, Rinde, Gräser, Kräuter, Blätter |
| Feinde | Dingos, Haushunde, Hauskatzen |
| Verbreitung | Australien, Neuguinea |
| Lebensraum | Wälder, Buschlandschaften |
| Ordnung | Diprotodontia |
| Familie | Kängurus |
| Wissenschaftl. Name | Notamacropus |
| Merkmale | Kleine, schlanke Kängurus, die in Wäldern leben |
Merkmale und Besonderheiten
Wallabys sind Beuteltiere. Sie gehören zur Familie der Kängurus, unterscheiden sich aber stark von dem Roten und dem Grauen Riesenkänguru. Sie sind klein, schlank und leben in Wäldern – nicht in offenen Landschaften. Sie haben auffällige Zeichnungen wie weiße Streifen im Gesicht, schwarze Streifen am Rücken oder rotes Fell im Nacken.

Name
Der Name Wallaby stammt aus der Sprache der Aborigines (ein indigenes Volk Australiens). Bei ihnen hieß das Tier „walabi“ oder „waliba“.
Arten
Es gibt acht Arten: das Flinkwallaby, das Rückenstreifenwallaby, das Derbywallaby, das Östliche und Westliche Irmawallaby, das Parmawallaby, das Hübschgesichtwallaby und das Rotnacken- oder Bennettwallaby. Das Sumpfwallaby gehört nicht zu den Wallabys. Es hat seine eigene Gattung. Auf Englisch gibt es noch viel mehr Kängurus, die Wallabys heißen, aber nicht zu den Wallabys im engeren Sinne gehören.
Verbreitung und Lebensraum
Der natürliche Lebensraum von Wallabys sind küstennahe Wälder und Buschlandschaften im Süden, Osten und Norden Australiens. Das Flinkwallaby lebt außerdem in Neuguinea.
Lebensweise
Wallabys sind vor allem in der Dämmerung und nachts aktiv.

Körperbau und Aussehen
Größe und Gewicht
Das größte und schwerste ist das Rotnackenwallaby. Es hat eine Körperlänge von 90-105 cm und ein Gewicht von 14-19 kg. Ihr Schwanz wird 70-75 cm lang. Das kleinste und leichteste ist das Derbywallaby. Es wird nur 52-68 cm lang und wiegt 4-9 kg. Der Schwanz wird 33-45 cm lang.
Zähne
Schädel, Kiefer und Zähne der Wallabys sind im Vergleich zu den großen Riesenkängurus natürlich kleiner – aber auch kräftiger. Sie ernähren sich nicht von weichem Gras, sondern von harten, faserigen Blättern. Sie könenn kräftiger zubeißen als ihre großen Verwandten.
Schwanz
Wallabys haben einen kräftigen, muskulösen Schwanz. Genau wie den großen Kängurus hilft er ihnen, das Gleichgewicht zu halten.

Wallaby oder Riesenkänguru – Wo ist der Unterschied?
Umgangssprachlich werden alle kleinen Kängurus als Wallabys bezeichnet. Tatsächlich haben Wallabys ihre eigene Gattung und unterscheiden sich deutlich von den großen Riesenkängurus, also dem Grauen Riesenkänguru und dem Roten Riesenkänguru. Riesenkängurus sind meistens doppelt so groß und sind 3-4 Mal so schwer. Sie haben längere Beine, machen kräftige, weite Sprünge, bilden große Gruppen und leben in offenen Landschaften. Wallabys sind viel kleiner und schlanker. Sie haben kurze Beine, machen kurze Sprünge und leben eher einzelgängerisch in Wäldern oder Buschlandschaften.
Ernährung
Wallabys sind Pflanzenfresser. Sie ernähren sich von Knospen, Farnen, Rinde, Gräsern, Kräuter und Blättern.
Verhalten
Verteidigung
Wallabys sind immer „ganz Ohr“! Wenn sie hören, dass sich ein Raubtier nähert, klopfen sie mit ihren Hinterbeinen auf den Boden. Sie schlagen quasi Alarm. Außerdem geben sie leise, heisere Geräusche von sich, um ihre Artgenossen zu warnen. Sie versuchen immer zuerst, zu fliehen. Wenn das aber nicht geht und es zu einem Kampf kommt, verteilen sie Tritte mit ihren kräftigen Hinterbeinen und Boxen mit ihren Fäusten.
Sind Wallabys gefährlich?
Wallabys sind nicht angriffslustig und nicht aggressiv. Sie greifen Menschen nicht aktiv an. Aber! Wer ein Wallaby bedrängt, um beispielsweise ein Selfie mit ihm zu machen oder um es zu streicheln, muss damit rechnen, dass das dem Wallaby nicht unbedingt gefällt. Es fühlt sich möglicherweise bedroht. In diesem Fall wird es mit seinen kräftigen Hinterbeinen treten und mit seinen Fäusten boxen. Wallabys können – wie alle Wildtiere – durch Verletzungen Krankheiten übertragen, egal wie klein sie sind.
Sinne und Fähigkeiten
Sinne
Die Augen der Wallabys befinden sich seitlich am Kopf. Dadurch haben sie eine gute Rundumsicht und können Raubtiere schon von weitem erkennen. Am besten ist ihr Hörsinn ausgebildet. Da sie ihre Ohren unabhängig voneinander bewegen können, können sie Geräusche aus allen Richtungen wahrnehmen.
Geschwindigkeit
Das Flinkwallaby ist das schnellste Wallaby. Es kann eine Geschwindigkeit von 48 km/h erreichen.
Salzwasser trinken
Das Derbywallaby hat eine ganz besondere Fähigkeit: Es kann Salzwasser trinken, um seinen Flüssigkeitsbedarf zu decken. Wir Menschen könnten das nicht, denn unsere Nieren sind nicht dafür gemacht. Aber auch das Derbywallaby schafft es nicht, ausschließlich Salzwasser trinken und tut es nur, bevor es verdurstet.

Lebenserwartung
In freier Wildbahn werden Wallabys 8-10 Jahre alt. Freilaufende Hauskatzen und Haushunde sowie Füchse sind jedoch meistens dafür verantwortlich, dass sie nicht so lange leben.
Feinde und Bedrohungen
Natürliche Feinde
Die größten natürlichen Feinde der Wallabys sind Dingos, Tasmanische Teufel und Keilschwanzadler.
Der Mensch
Verlust von Lebensraum
Die Flächen, die für Landwirtschaft gebraucht werden, nehmen ständig zu. Das bedeutet aber auch, dass einheimische Tiere wie die Wallabys weniger Lebensraum haben. Sie brauchen dichte Wälder und Buschlandschaften. Weltweit werden 70 % der landwirtschaftlichen Flächen genutzt, um Futter für Nutztiere anzubauen. Wenn weniger Fleisch gegessen würde, könnten wir gleichzeitig mehr Menschen satt machen und würden weniger Flächen benötigen.
Eingeschleppte Tierarten
In Australien gab es ursprünglich keine Haushunde, Hauskatzen und Füchse. Sie wurden nach Australien eingeschleppt. Alle drei Tierarten jagen Wallabys – weil Hunde oft ohne Leine laufen dürfen und die meisten Katzen Freigänger sind (= nach draußen dürfen). Außerdem wurden Kaninchen, Ziegen, Rinder und Schafe eingeschleppt. Sie nehmen den Wallabys die Nahrung weg.
Gefährdungsstatus
Die meisten Wallabys gelten nicht als bedroht. Das Östliche Irmawallaby gilt jedoch als ausgestorben. Das Parma- und Derbywallaby haben einen sehr kleinen Lebensraum, weshalb die Arten bald gefährdet sein könnten.
Bedeutung für das Ökosystem
Das Wallaby verteilt mit seinem Kot überall Samen und sorgt dadurch für neue Pflanzen.
Wallaby als Haustier
Wallabys sind Wildtiere und daher keine guten Haustiere. Sie dürfen nicht allein gehalten werden, brauchen sehr viel Platz und brauchen bestimmte Pflanzen. Sie lassen sich auch nicht zähmen wie Hunde oder Katzen und treten kräftig, wenn sie bedrängt werden.

Fortpflanzung
Tragzeit, Geburt und Zeit im Beutel
Wallabys haben – für ein Säugetier – eine sehr kurze Tragzeit von nur 28-35 Tagen. Sie bekommen ein einzelnes Baby, das sehr unterentwickelt ist. Es wiegt nur wenige Gramm und krabbelt nach der Geburt sofort vom Geburtskanal in den Beutel. Dort saugt es sich an einer Zitze fest, um Muttermilch zu trinken. Es verbringt 6-9 Monate im Beutel, bis es groß genug ist, ihn zu verlassen.
Diapause
Kängurus haben die Fähigkeit der sogenannten Diapause. Auf Deutsch bedeutet das Wort so viel wie „Keimruhe“. Gemeint ist damit, dass sich der Embryo für eine gewisse Zeit nicht weiterentwickelt- es macht quasi eine Pause. Das ist eine gute Sache! Denn auf diese Weise kann die Mutter sicher stellen, dass ihr Nachwuchs zum richtigen Zeitpunkt richtig versorgt wird. Die Keimruhe kann bis zu 11 Monate dauern (beim Derbywallaby). Ein Wallaby kann sogar Dreifach-Mutter sein, wenn sie ein Embryo in der Keimruhe hat, ein Junges im Beutel und ein Jungtier, das bereits den Beutel verlassen hat. Das ist beim Flinkwallaby der Fall.
Das Wallaby ist verwandt mit:
- Baumkänguru
- Felskänguru
- Hasenkänguru
- Rattenkänguru
- Quokka
- Sumpfwallaby
Weitere Tiere im Lebensraum:
- Dingo
- Ameisenigel
- Fledermaus
- Flughund
- Hund
- Katze
- Keilschwanzadler
- Rotfuchs
- Tasmanischer Teufel
News zum Thema:
Artikel zum Thema:
Quellen:
- „Functionally mediated cranial allometry evidenced in a genus of rock-wallabies“ (https://royalsocietypublishing.org)
- „Parma wallabies: a history of translocations and reintroductions“ (https://meridian.allenpress.com)